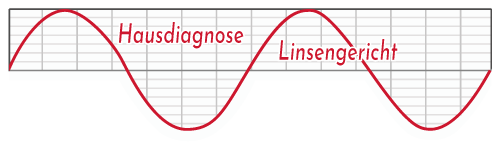OSB-Platten finden heute hauptsächlich Anwendung in neuen Fertighäusern. Oftmals bestehen dort die Wandbeplankungen, Deckenverkleidungen und Fußböden aus OSB-Platten. Auch im Rahmen der Altbausanierung werden OSB-Platten heute oftmals verwendet. Bei OSB-Platten kann es häufig zu Ausgasungen kommen von:
- Terpene (aus dem Baumharz der verwendeten Holbestandteile)
- Aldehyde wie Hexanal (häufig Ursache für Gerüche9
- Essigsäure
- Ameisensäure
- Formaldehyd (heute eher selten, aber möglich bei minderwertigen Produkten
Die Emissionen diverser Substanzen aus Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten werden insbesondere vom Rohstoff (Holz / Einjahrespflanze, Kern- und Splintholz, Einschlagszeit, Standort des Baumes, Alter, Lagerung etc.) und den Herstellungsbedingungen (insbesondere Temperatur bei der Trocknung und beim Pressen) beeinflusst.
Zudem führt nach Untersuchungen des Umweltbundesamtes eine Verkleidung der OSB-Platten mit z.B. Gipskartonplatten, wie es für den Wandaufbau üblich ist, nicht zu einer Abschirmung der Schadstoff-Emissionen!
Insbesondere für sehr empfindliche Personengruppen (Allergiker, MCS-Kranke, Kleinkinder, Personen mit reduziertem Immunsystem) sind OSB-Platten nicht zu empfehlen. Vor allem bei erhöhten Temperaturen wie an Fassaden oder in Dachwohnungen ist mit stärkeren Ausgasungen zu rechnen.
Aus „höherwertigen“ OSB-Platten entweichen i.d.R. weniger der vorgenannten Schadstoffe. Solche Werkstoffe zu finden, ist allerdings nicht einfach.
Im Zweifelsfall sollte man deshalb auf OSB-Platten eher verzichten und z.B. auf Gipsfaserplatten oder andere mineralisch gebundene Plattenwerkstoffe zurückgreifen.